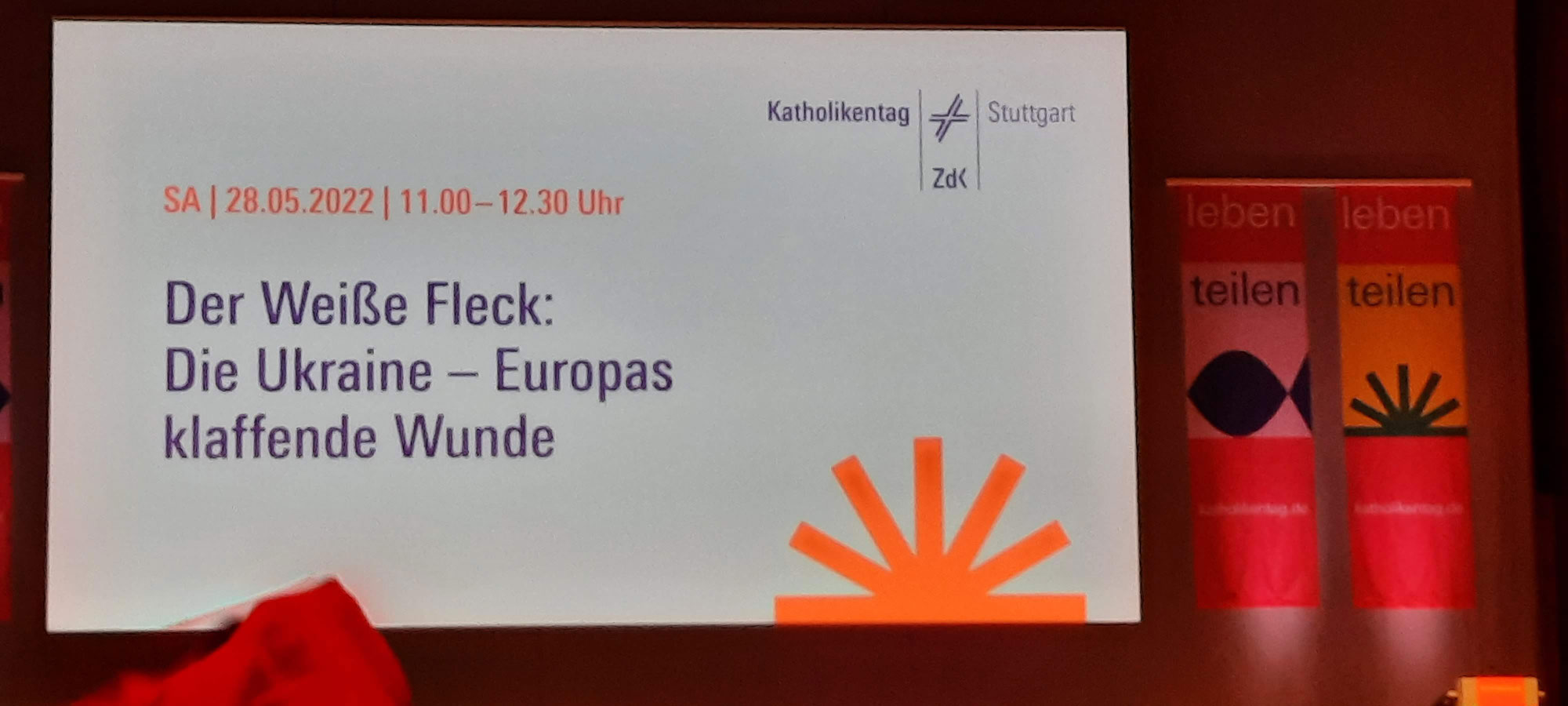Wehrbeauftragte Högl fordert Ausbau der Militärseelsorge
Wehrbeauftragte Högl fordert Ausbau der Militärseelsorge
(KNA)
Die Militärseelsorge ist nach Angaben der Wehrbeauftragten der Bundesregierung, Eva Högl (SPD), für die Bundeswehr von enormer Bedeutung. Dabei gehe es neben der Ausübung der Religion um eine umfassende Unterstützung im Dienst, ob in Übung oder im Einsatz, um die alltäglichen Sorgen und Nöte wie auch um den Beistand in familiären und persönlichen Fragen, heißt es in dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Jahresbericht 2022. Darin drängt Högl auf einen raschen Aufbau einer religionsbezogene Seelsorge für Muslime und den Ausbau der jüdischen Militärseelsorge. Militärseelsorge stärkt mit ihrer vielfältigen Arbeit unverzichtbar die Einsatzbereitschaft der Truppe, heißt es in der Studie. Im Zuge der Zeitenwende und der damit verbundenen Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigungwerde sie sich verändern und zunehmend auf die Organisation der seelsorgerischen Betreuungsangebote für die Landes- und Bündnisverteidigung ausrichten müssen. Dabei sei es eine gute Tradition, dass die Seelsorge für alle oen sei. Der Bericht betont in diesem Zusammenhang auch den Lebenskundlichen Unterricht (LKU). Die Praxis habe sich bewährt und gewährleistet den so geschätzten hierarchiefreien Raum zur freien Meinungsäußerung. Der Unterricht sei kein Religionsunterricht sondern solle das Gewissen schärfen, moralisches Urteilsvermögen ausbilden und so das verantwortungsbewusste Handeln unterstützen.
Högl erwartet die neue Vorschrift zur ethischen Bildung Anfang kommenden Jahres. Die Wehrbeauftragte forderte, seelsorgerische Betreuungsangebote auf Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften außerhalb der christlichen und jüdischen Militärseelsorge zu erweitern. Dabei müsse zügig ein Ergebnis für die rund 3.000 muslimischen Soldaten gefunden werden. Sie sprach sich für eine seelsorgerische Betreuung auf einzelvertraglicher Basis aus. Gleichzeitig plädierte sie für mehr Personal im Militärrabbinat. Herausfordernd sei eine gleichberechtigte Besetzung mit orthodoxen wie liberalen Rabbinern.
Als weiterhin sensibles Thema bezeichnete Högl die umstrittene Einstellung von Soldaten unter 18 Jahren. Sie sollte die Ausnahme bleiben. Allerdings betreffe dies fast zehn Prozent der Neueinstellungen im Berichtsjahr. Deshalb wolle die Bundeswehr nicht auf sie verzichten. Die Bundesregierung habe aber vor, ihre Tätigkeit weiter einschränken, über ein Verbot des Dienstes an der Waffe oder von Auslandseinsätzen hinaus. Dazu sein ein gutes Konzept nötig.
Högl begrüßte die Debatte um eine mögliche Dienstpflicht. Allerdings löse sie weder kurzfristig noch mittelfristig die Personalprobleme. Entscheidend seien bessere Rahmenbedingungen. Die Wehrbeauftragte bekräftigte zudem ihre Forderung nach einer Null-Toleranz-Politik bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Laut Bericht stieg deren Zahl 2022 auf 357 gegenüber 303 im Vorjahr, bei einer angenommenen höheren Dunkelziffer. 80 Prozent der Betroffenen seien weiblich und ein Drittel der Übergriffe fand demnach unter Alkoholeinuss statt.
Zum Bericht der Wehrbeauftragten 2023: https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005700.pdf
 Neues aus Kirche und Welt:
Neues aus Kirche und Welt:
Nuntius: Heiliger Stuhl steht für Vermittlung in Ukraine bereit
(KNA)
Der Heilige Stuhl ist nach den Worten des Apostolischen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, weiter bereit, zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation zu vermitteln. Papst Franziskus und seine engsten Mitarbeiter hätten wiederholt versichert, dass er dazu bereit sei, sofern dies beide Seiten ernsthaft wünschen und sie bereit dazu sind, sich für einen gerechten und dauerhaften Frieden einzusetzen, sagte Eterovic am Dienstag in Berlin. Der Erzbischof äußerte sich beim Empfang der Nuntiatur aus Anlass des zehnten Jahrestages des Beginns des Pontifikates von Papst Franziskus. Der Frieden in der Welt habe Priorität für die katholische Kirche, sagte der Erzbischof. Viele Beispiele zeigten, dass der Heilige Stuhl bereit sei, seine Dienste in Konflikten zwischen Staaten oder innerhalb eines Landes anzubieten. Das gilt auch angesichts der Tragödie des Krieges in Ukraine, betonte er. Angesichts von überwiegend regionalen Ausbrüchen von Gewalt und Krieg habe Papst Franziskus zu Beginn seines Pontifikates voller Sorge vom Dritten Weltkrieg in Teilen gesprochen. Im Laufe der Jahre sei diese Bezeichnung mehr und mehr aktuell, besonders mit dem 24. Februar 2022, als die Russische Föderation die Ukraine überfallen hat und nicht nur das internationale Recht in die Krise stürzte.
Als Beispiel der diplomatischen Bemühungen des Heiligen Stuhls nannte Eterovic die Vermittlungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Kuba, um die unterbrochenen Beziehungen dieser beiden Staaten zu normalisieren. Ebenso habe der Heilige Stuhl bei der Vermittlung in unterschiedlichen Ländern eine Rolle gespielt, etwa bei den Friedensprozessen in Kolumbien und Mosambik. Besonderes Augenmerk lege der Heilige Stuhl auf die Suche nach Frieden in der Republik Südsudan.

Bischof: Opfer und Aggressor im Ukraine-Krieg nicht verwechseln
(KNA)
Opfer und Aggressor dürfen beim Krieg Russlands gegen die Ukraine nach den Worten von Bischof Bohdan Dzyurakh nicht verwechselt werden. „Der Krieg ist kein Fußballspiel mit zwei gleichberechtigten Gegnern“, sagte der ukrainische griechisch-katholische Exarch für Deutschland und Skandinavien. Es gebe einen Aggressor, der das Völkerrecht gebrochen habe, und es gebe ein Opfer, das auf brutale Weise angegriffen wurde. Auf die Forderung westlicher Intellektueller angesprochen, nicht in den Konflikt einzugreifen, um das Leiden in der Ukraine nicht zu verlängern, erinnerte der Exarch an ein Zitat von Johannes Paul II. So habe der Papst einmal gesagt, es gebe keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. „Manchmal sind wir enttäuscht über das Zögern der westlichen Politiker“, erklärte Dzyurakh. Ukrainische Verantwortliche hätten noch kurz vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine vor einem Jahr nur wenig Unterstützung erfahren. „Dieses Gefühl der Verlassenheit war nicht weniger schmerzhaft als der Angriff selbst.“ Umso wichtiger seien die Massendemonstrationen und die Welle der Hilfsbereitschaft zur Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge gewesen, so der Bischof. Europa sei nun aufgewacht und habe entdeckt, dass es in der Ukraine um den gesamten Kontinent gehe: „Es sind einfache Menschen, die in der Ukraine ihr Leben für Freiheit, Würde und Gerechtigkeit hingeben. Und dadurch zeigen sie auch den westlichen Politikern, dass es etwas gibt, wofür man nicht nur leben soll, sondern auch bereit sein kann zu sterben.“ In der Wahrnehmung des Westens habe der Krieg vor einem Jahr begonnen, sagte Dzyurakh. Doch das sei nicht richtig. „Er dauert schon fast neun Jahre. Seit März 2014 wurde die Ukraine Opfer der russischen Aggression: Zuerst durch die gesetzeswidrige Annexion der Krim und dann durch die Kämpfe in der Ostukraine.“ Das sei oft vergessen, verschwiegen und ignoriert worden. In der Ukraine sei derzeit die Lage aufgrund der zerstörten Infrastruktur sehr angespannt, erinnerte der Bischof. Millionen von Menschen leben Tag und Nacht ohne Strom, Heizung und Wasser. Die Kirche habe Wärmezelte eingerichtet und Stromgeneratoren zur Verfügung gestellt: „Wir werden alles tun, um den Menschen zu helfen. Es ist die schwierigste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg“, so Dzyurakh.
Anmerkung:
Bischof Bohdan Dzyurakh, Apostolischer Exarch für die Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien, Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche

Vatikanbehörde für Bildung neu besetzt - Bischof Overbeck dabei
(KNA)
Papst Franziskus hat die Vatikanbehörde für Bildung und Kultur in der Weltkirche personell neu aufgestellt. Nach der im Herbst ernannten Führungsspitze nominierte er am Samstag die Mitglieder der Einrichtung, die unter anderem für katholische Schulen und Hochschulen weltweit zuständig ist. Einziger deutscher Vertreter ist der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck; als Schweizer rückt Bischof Charles Morerod, Leiter des Bistums Lausanne-Genf-Fribourg, in das Gremium. Während der emeritierte Bischof Valerio Lazzeri aus dem schweizerischen Lugano seinen Platz behält, ist Kardinal Kurt Koch kein Mitglied mehr. Leiter der Behörde, die im Zug der Kurienreform von Franziskus vergangenes Jahr umstrukturiert wurde, ist seit September der portugiesische Kardinal Jose Tolentino de Mendonca. Den dritthöchsten Posten nimmt hinter dem Sekretär Giovanni Cesare Pagazzi seit November die Wirtschaftsrechtlerin Antonella Sciarrone Alibrandi ein.
Neben 15 Mitgliedern im Kardinalsrang und 16 weiteren im Rang eines Erzbischofs oder Bischofs umfasst die Behörde drei männliche Laienkatholiken als Mitglieder sowie 42 Berater. Zu diesen zählen der in Lugano lehrende Schweizer Kirchenrechtler Andrea Stabellini und der Deutsche Ulrich Rhode, Dekan der Kirchenrechtsfakultät an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, und der Direktor der Katholischen Akademie in Berlin, Joachim Hake.
Von den 42 sogenannten Konsultoren sind 19 Geistliche, drei Ordensfrauen und vier weibliche Laienkatholiken.
Spenden einmal anders
Zehn Ideen für Helfen ohne Geld
Egal ob vor oder nach den Feiertagen - Spenden werden immer gebraucht. Die Deutschen spendeten zuletzt Geld in Rekordhöhe, aber auch mit zahlreichen anderen Mitteln kann geholfen werden.
von Nicola Trenz (KNA)
Die Zeit vor und nach Weihnachten ist auch eine Zeit der Nächstenliebe. Ob mit Spendengalas im Fernsehen, Straßensammlungen oder digitalen Werbeanzeigen, überall werben Hilfsorganisationen um Geldspenden. Aber auch jenseits von finanziellen Hilfen kann jede und jeder helfen.
Hier sind zehn Alternativen für sinnvolles Spenden - ganz ohne Geld:
Kronkorken
Die Getränkeverschlüsse bestehen aus wertvollem Metall. Ob für Darmkrebs-Patienten oder für ein Waschmobil für Obdachlose, mehrere Vereine sammeln die kleinen Blechstücke, verkaufen sie an Metallhändler und nutzen die Erlöse für einen sinnvollen Zweck.
Handys
Rund 300 Millionen alte Handys, Tablets und Laptops liegen laut einer Studie ungenutzt in deutschen Schubladen. Damit lagern unzählige Rohstoffe in den Haushalten, denn Edelmetalle wie Kupfer, Nickel und Gold sind in den Geräten verbaut. Die Hilfsorganisation Missio etwa sammelt seit mehreren Jahren defekte Handys und nutzt die Erlöse des Recyclings der Geräte für ihre Projekte.
Haare
Sind die Haare mindestens 25 Zentimeter lang, können sie für Perücken gespendet werden. Ob beim Friseur oder selbst geschnitten, den möglichst geflochtenen Zopf einfach in einen Umschlag und an entsprechende Stellen schicken. Aus den Haaren werden Perücken für Krebspatientinnen gefertigt.
Blut
Bei einer Vollblutspende wird etwa ein halber Liter Blut entnommen und haltbar gemacht. Ob nach Unfällen oder Operationen, das gespendete Blut kann Leben retten. Spenden kann in der Regel, wer über 18 Jahre alt ist, mehr als 50 Kilogramm wiegt.
Brillen
Bei Optikern, Apotheken oder auch in Kirchen gibt es Sammelboxen für alte Brillen. Die Aktion „Brillen weltweit“ sichtet und bearbeitet die Brillenspenden und versendet sie nach eigenen Angaben an gemeinnützige Organisationen, die dann Sehhilfebedürftige über Krankenstationen oder andere soziale Stützpunkte auf allen Erdteilen erhalten.
Altpapier
In manchen Orten sammeln gemeinnützige Organisationen Kartonagen, Kataloge und weggeworfene Bücher für einen guten Zweck, denn Wertstoffhändler zahlen Geld für große Mengen an abgegebenen Papier. Die Erlöse der Altpapiersammlungen fließen dann in gemeinnützige Projekte. Alternativ freut sich vielleicht der Kindergarten um die Ecke über Klopapierrollen zum Basteln oder einseitig bedrucktes Papier zum Bemalen.
Briefmarken
Auch gestempelte Postwertzeichen können Gutes tun, ob vom Umschlag ausgerissen oder aus der Briefmarkensammlung. So sammeln etwa die Stiftungen Bethel seit Jahrzehnten Briefmarken. Die dort angestellten Menschen mit Behinderung sichten die Marken und bereiten sie für den Wiederverkauf an Sammler und Händler vor. Der Erlös fließt in die Arbeit der Stiftungen Bethel. Die Briefmarkenstelle Bethel sichert laut eigenen Angaben Arbeitsplätze für rund 125 Menschen mit Behinderung.
Kleidung
Das Spenden von Altkleidern und anderen Sachgegenständen ist ein Spenden-Klassiker. Kleiderkammern, Sozialkaufhäuser oder andere Einrichtungen vor Ort nehmen die Spenden gerne entgegen. Beim Kleiderspenden in einen Altkleidercontainer ist darauf achten, dass der Container zu einer Organisation gehört, die dem Dachverband gemeinnütziger Altkleidersammler „FairWertung“ angeschlossen ist.
Spenden beim Kaufen
Auch mit dem eigenen Konsum können Vereine und Hilfsorganisationen unterstützt werden. Der Internetriese Amazon beispielsweise betreibt smile.amazon. Wer darüber einkauft, spendet mit dem Kauf einen Teil der Einkaufssumme an eine gemeinnützige Organisation nach eigener Wahl. Extrakosten für den Kunden kommen nicht dazu.
Zeit
Wohl das wichtigste Gut in Sachen Gutes tun - Jede und jeder kann einen Teil ihrer oder seiner Zeit für die sinnvolle Sache einsetzen und so Talente und Fähigkeiten mit Anderen teilen. Vom Gassiführen von Tierheimhunden bis zum Deutschunterricht für Geflüchtete - die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.

Studie: Fleischfreier Freitag könnte Klima erheblich verbessern
(KNA)
Laut einer neuen Studie der Universität Cambridge könnte Papst Franziskus einen erheblichen Einfluss auf das Klima nehmen. Denn wenn das Kirchenoberhaupt den fleischfreien Freitag, wie er früher in katholischer Tradition üblich war, wieder einführen würde, könnten damit jährlich millionen Tonnen CO2 eingespart werden, heißt es in einer nun veröffentlichten Studie der Hochschule.
„Mit mehr als einer Milliarde Anhängern auf der ganzen Welt ist die Katholische Kirche in einer sehr guten Position, um den Klimawandel abzumildern“, erklärte Studienleiter Shaun Larcom.
Franziskus habe sich immer wieder entschieden für radikale Antworten auf den Klimawandel ausgesprochen. „Wenn der Papst die Verpflichtung zum fleischfreien Freitag wieder für alle Katholiken der Welt einführt, könnte das einer der wichtigsten Ausgangspunkte für günstige Emissionsverminderungen sein, so Larcom.
Die Forscher nahmen als Grundlage Zahlen aus dem Vereinigten Königreich: Als 2011 die katholischen Bischofe von England und Wales zur Rückkehr zum fleischfreien Freitag aufgerufen hatten, habe ungefähr ein Viertel der rund sechs Millionen Katholiken seine Essgewohnheit dementsprechend umgestellt. Dadurch wurden laut der Studie rund 55.000 Tonnen Treibhausgase im Jahr eingespart. Das zeige, dass, selbe wenn global nur eine Minderheit der Katholiken dem Aufruf des Papstes folgen würde, das den CO2-Ausstoß schon erheblich reduzieren könnte, betonte Larcom.
Die Fleischindustrie gilt als einer der Hauptantreiber des Klimawandels. So produziere ein Kilogramm Rindfleisch rund 13,3 Kilogramm CO2, beim Kilo Geflügel- und Schweinefleisch liege der Wert bei 3,5 bzw. 3,3 Kilogramm.
Der fleischfreie Freitag ist eine traditionelle Form des Verzichts in der katholischen Kirche. Er geht auf die Vorstellung zurück in Anlehnung an den Karfreitag, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, ein Opfer zu bringen, etwa durch Fleischverzicht.
Tafeln in der Krise - Immer mehr Bedürftige und weniger Spenden
(KNA)
Die 172 Tafeln in Nordrhein-Westfalen stehen vor einem schwierigen Winter. Laut einem Bericht der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung nimmt die Zahl der Bedürftigen stark zu, während gleichzeitig die Spendeneinnahmen zurückgehen. „Die Tafeln fühlen sich in der Krise“, sagte die Sprecherin des Landesverbandes Tafel NRW, Petra Jung, den Zeitungen. „Vor Beginn des Ukraine-Krieges hatten wir landesweit etwa 350.000 Kunden, jetzt sind es mindestens 500.000“, so Jung. Darunter seien nicht nur viele neue Bedürftige wie etwa Geflüchtete aus der Ukraine, sondern auch Rentner, die während der Corona-Krise lange ferngeblieben seien, nun aber wiederkämen, „weil sie angstvoll auf die kommenden Energierechnungen warten“. Wegen der Vielzahl an Neukunden hätten manche Tafeln bereits Aufnahmestopps verhängt. Es sei eine enorme psychische Belastung für die Ehrenamtler, wenn sie Menschen wegschicken müssten. Zugleich registrieren die Tafeln in NRW der Sprecherin zufolge einen deutlichen Rückgang bei Geld- und Sachspenden. Er habe nach Ausbruch des Ukraine-Krieges begonnen, sagte Jung. „Viele Menschen spenden eben nur einmal.“ Auch die Supermärkte, von denen die Tafeln Lebensmittel beziehen, kalkulierten spitzer. „Es bleibt weniger für uns übrig.“
 Neues aus Kirche und Welt
Neues aus Kirche und Welt
Theologe regt gemeinsame Kirchen-Initiative gegen den Krieg an
(KNA)
Angesichts der befürwortenden Haltung der russisch-orthodoxen Kirche zum Krieg gegen die Ukraine hat der Paderborner Theologe Wolfgang Thönissen eine gemeinsame Initiative der anderen Kirchen angeregt. „Die orthodoxen Kirchen müssen untereinander klären, wie sie künftig mit der russisch-orthodoxen Kirche umgehen wollen“, sagte der langjährige Leitende Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn. „Waffen segnen und einen Angriffskrieg unterstützen, kann ich beim besten Willen nicht für eine mögliche christliche Position halten“, betonte Thönissen. Die anderen orthodoxen Kirchen sollten überlegen, ob man nicht einen Vorstoß in Richtung der westlichen Kirchen wage. Das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel, könnte die Initiative ergreifen, alle bereitwilligen orthodoxen Kirchen mitzunehmen, um das Band zu den westlichen Kirchen zu festigen, schlug Thönissen vor, auf der Grundlage, dass alle Kirchen für Frieden sind und keine Kirche einen Krieg unterstützen kann.
 Zum GKS-Thema Allgemeiner Gesellschaftsdienst
Zum GKS-Thema Allgemeiner Gesellschaftsdienst
CDU-Entscheidung zu gesellschaftlichem Dienstjahr noch offen
(KNA)
Die Entscheidung der CDU über die Ausgestaltung eines allgemeinen Dienstjahrs ist nach Angaben von CDU-Generalsekretär Mario Czaja noch offen. Hier solle der Parteitag eine Richtungsentscheidung vornehmen, sagte Czaja am Montag in Berlin. Dabei gehe es vor allem um Frage, ob der Dienst junger Menschen freiwillig oder verpflichtend sein soll. Mit dem Thema befassen sich mehrere der über 484 Anträge des 35. Parteitags in Hannover.
Hier können Sie die Stellungnahme der GKS und das vom Sachausschuss Sicherheit und Frieden entwickelte Konzept zum Europ. Gesellschaftsdienst lesen Link: https://gemeinschaft-katholischer-soldaten.de/themen/allgemeiner-gesellschaftsdienst

Neuigkeiten aus Kirche und Welt
Papstbotschafter: Hoffnung in Syrien ist gestorben
(KNA)
Der Papstbotschafter in Syrien, Kardinal Mario Zenari, hat an die verheerende humanitäre Lage in Syrien erinnert. Es gebe kein Brot, kein Wasser, keine Elektrizität, keine Häuser, keine Jugend, klagte der Nuntius bei einer Pressekonferenz am Freitag in Rom.
Die Menschen hätten keine Stimme, die Hoffnung sei gestorben, schilderte der Kardinal die Situation in dem Krisenland. Erst vor zwei Tagen habe es wieder Bombenangriffe auf Flughäfen und Autobahnen gegeben, ergänzte Franziskanerbruder Fadi Azar aus Latakia. Der Krieg sei noch lange nicht vorbei.
Am Mittwoch hatte laut Medienberichten Israel den Flughafen von Aleppo und nahegelegene Lagerhäuser mit Raketen beschossen. Es wird demnach vermutet, dass in den Lagern iranische Raketen lagerten. Jeden Tag sehe er Menschen das Land verlassen, so Ordensmann Azar. Die Krisen der Welt seien in Syrien stärker spürbar, die Armut sehr groß, erklärte Zenari.
Die UN-Organisation OCHA schätzt, dass die humanitäre Notlage in Syrien rund 14,6 Millionen Menschen betrifft, eine Zunahme gegenüber 2021 um 1,2 Millionen. Der Krieg und seine langfristigen Folgen, wie etwa die weitgehende Zerstörung der zivilen Infrastruktur und der wirtschaftliche Niedergang, seien durch die Pandemie und die globale Wirtschaftskrise weiter verschärft worden. Etwa 80 Prozent der syrischen Bevölkerung leben den Angaben zufolge unterhalb der Armutsgrenze. Fast 11,5 Millionen Menschen, davon 40 Prozent Kinder, erhielten keine angemessene medizinische Versorgung.
Seit 2017 engagieren sich Zenari und Azar für das Projekt „Offene Krankenhäuser“ in Syrien. Menschen, die sich keine medizinische Behandlung leisten können, erhalten sie in drei Krankenhäusern kostenfrei. Zwei dieser Kliniken befinden sich in Damaskus, eine in Aleppo. An vier weiteren syrischen Orten werden medizinische Beratung, diagnostische Untersuchungen und Medikamentenausgaben angeboten.

Neuigkeiten aus Kirche und Welt
Expertin: Brauchen gegen Putin Mut und Entschlossenheit
(KNA)
Zur Person: Stefanie Babst
1991 Dozentin für Internationale Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität. 1993 wird sie erste weibliche Dozentin an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg; Schaffung des Lehrstuhls für Russland- und Osteuropastudien. 1993 – 1998 hat sie verschiedenen Gastdozenturen in den USA, der Russischen Föderation, der Ukraine und Tschechischen Republik; Arbeit für OSZE-Wahlbeobachterkommissionen, u.a. in Moskau. 1998 Wechsel in den Internationalen Stab der NATO als German Information Officer und Referatsleiterin. 2006 – 2012 ist sie Stellvertretende Beigeordnete Generalsekretärin für Public Diplomacy der NATO unter Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer (höchstrangigste deutsche Frau im Internationalen Stab der NATO). 2009 – 2020 Aufbau und später Leitung eines Krisenvorausschau- und strategischen Planungsstabs für die NATO unter Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Seit 2020 Strategische Beraterin und Publizistin; Mitgründerin von Brooch Associates, einer strategischen Beratungsfirma in London
Die Sicherheitsexpertin Stefanie Babst prognostiziert eine längere Auseinandersetzung mit Russland. „Wir sollten keine Ängstlichkeit, sondern unsere Durchhaltefähigkeit mobilisieren“, sagte die frühere Nato-Mitarbeiterin und heutige Politikberaterin am Mittwochabend im Sankt Paulus-Dom in Münster. „Wenn wir den aggressiven Putinismus nicht brechen, wird er versuchen, uns zu brechen. Deshalb brauchen wir Mut und Entschlossenheit.“
Deutschland sei für den Kreml ein primäres Ziel der hybriden Kriegführung, erklärte Babst. Moskau setze darauf, dass die Deutschen den Konflikt weder politisch noch wirtschaftlich durchhalten würden. Zugleich kritisierte sie, dass der Ukraine-Krieg in Deutschland mittlerweile zu einem Hintergrundgeräusch geworden sei. Babst forderte, Russlands revisionistische Ambitionen systematisch und nachhaltig zu begrenzen. Die Publizistin zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Sanktionspakete der EU Putin in große Bedrängnis bringen werden. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Ukraine ihre Souveränität und Integrität bewahren könne, sagte Babst. Auch müsse die EU den verletzlichen Nachbarstaaten wie Moldau und Georgien helfen, ihre Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität zu stärken. Vor allem aber müssten wir auch unsere eigene militärische Wehrhaftigkeit und Resilienz stärken und in die Bundeswehr investieren, so Babst. Der Westen solle zudem seine Beziehungen zu Russlands engeren Partnern wie China, Indien oder Iran überdenken.
 Edith Stein
Edith Stein
Vor 80 Jahren ermordeten die Nazis Edith Stein in Auschwitz - Jüdin, Christin, Philosophin, Heilige
Sie engagierte sich in der Philosophie unter anderem bei Edmund Husserl und wirkte als Ordensschwester. Das reiche Leben der heiligen Edith Stein, die als Jüdin geboren worden war, nahm ein tragisches und zu frühes Ende. Von Leticia Witte (KNA)
Sie ist eine der Patroninnen Europas: Edith Stein. Geboren wurde sie in eine jüdische Familie, entschied sich später für die christliche Taufe, engagierte sich in der Philosophie, wirkte als Ordensfrau und wurde schließlich von den Nazis in Auschwitz ermordet. Das geschah vor 80 Jahren, am 9. August 1942.
Papst Johannes Paul II. sprach Teresia Benedicta vom Kreuz - so ihr Ordensname - 1987 selig, ein Jahr später heilig. Er nannte die aus Breslau (Wroclaw) stammende Stein bei der Seligsprechung in Köln eine herausragende Tochter Israels und zugleich Tochter des Karmels. Sie sei zudem eine Persönlichkeit, die eine dramatische Synthese unseres Jahrhunderts in ihrem reichen Leben vereint. Dieses Leben war in der Tat reich: im Glauben, im Spirituellen, in der Philosophie. Und auch in den Überzeugungen.
Stein wurde am 12. Oktober 1891 als jüngstes von elf Kindern einer jüdischen Familie geboren. Ihr Vater starb früh, und ihre Mutter kümmerte sich seitdem um den Holzhandel der Familie. Zeitweise bezeichnete sich Stein als Atheistin. Nach dem Abitur widmete sie sich an der Universität Breslau der Germanistik, Geschichte und Philosophie. Später ging sie nach Göttingen zu dem Phänomenologen Edmund Husserl, bei dem sie in Freiburg nach Dienst in einem Lazarett im Ersten Weltkrieg 1917 promovierte. Weiter ging es jedoch nicht, denn als Frau hatte sie keine Aussicht auf eine Habilitation. Im Anschluss an ihre Stelle in Freiburg hielt sich Stein an unterschiedlichen Orten auf, schrieb und lehrte.
1921 passierte etwas, das für Stein, wie manch anderes auch, wegweisend war: Sie las die Autobiografe der heiligen Teresa von Avila und befand: „Das ist die Wahrheit.“
Am Neujahrstag 1922 ließ sie sich dann katholisch taufen. Im April 1933 rief Stein Papst Pius XI. zu einer Stellungnahme angesichts der Hetze gegen Juden in Deutschland auf - vergeblich. Immer stärker brach der NS-Judenhass hervor, und im Jahr der Novemberpogrome 1938 musste auch Stein, die Konvertitin, fliehen. Sie kam im Karmel im niederländischen Echt unter, in dem auch ihre konvertierte Schwester Rosa Dienst tat.
Anfang August 1942 wurden sie abgeholt - wohl im Zuge einer Racheaktion für ein Protestschreiben niederländischer katholischer Bischöfe gegen die Umtriebe der Nationalsozialisten.
Am 9. August starben Edith und Rosa Stein im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.
Edith Stein soll zuvor zu ihrer Schwester gesagt haben: „Komm, wir gehen für unser Volk.“
 Neues aus Kirche und Welt
Neues aus Kirche und Welt
Bundesregierung gibt 880 Millionen Euro für Kampf gegen Hunger
Die Bundesregierung stellt 880 Millionen Euro zur Verfügung, um den weltweiten Hunger zu bekämpfen. Laut einem Papier, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag zitieren, investiert das Entwicklungsministerium (BMZ) die Mittel dort, „wo die Not am größten ist, weil sich mehrere Krisen überlappen“ wie in den dürrgeplagten Ländern Äthiopien, Sudan und Kenia. Deutschland habe damit eine erste Zusage von 430 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Bundeskanzler Olaf Scholz im März gemachte hatte, um die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewältigen.
Deutschland koordiniert seit dem G-7-Gipfeltreffen in Elmau die Vergabe der Sondermittel. Unterstützung sollen auch Staaten erhalten, die besonders unter Klimawandel und bewaffneten Konflikten leiden, wie die Sahel-Zone und die Länder im Nahen Osten. Sie sind, wie etwa der Libanon, Hauptzufluchtsort für syrische Flüchtlinge und haben selbst mit steigenden Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen. Den Angaben zufolge werden auch Tunesien und Ägypten unterstützt, die stark von Getreideimporten aus Russland und der Ukraine abhängig sind.
Lambrecht: Militärseelsorge „stille Reserve am Standort“
KNA
Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Einsatz der evangelischen Militärseelsorge gewürdigt. Die Geistlichen seien „die stille Reserve am Standort“, sagte sie bei einem Festakt zum 65-jährigen Jubiläum der evangelischen Militärseelsorge am Montag in der Potsdamer Nikolaikirche. Sie habe bei Truppenbesuchen erfahren, dass sich Einsatzkontingente ohne Militärpfarrer „nackt“ fühlten, so die Ministerin. „In den Auslandseinsätzen kann man sehen, wie wichtig, wie essentiell die Militärgeistlichen sind.“
Der evangelische Militärseelsorgevertrag wurde am 22. Februar 1957 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU), Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU), dem damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Otto Dibelius und dem Leiter der Kirchenkanzlei, Heinz Brunotte, unterzeichnet. Er regelt bis heute das Verhältnis von Kirche und Staat in der Militärseelsorge. Der Vertrag war ein Meilenstein der Verankerung der neuen Streitkräfte in der Bevölkerung.
Ökumenisches Friedensgebet 2022
Eine Intitiative von missio + Evangelische Mission weltweit
Gütiger Gott, wir sehnen uns danach,
miteinander in Frieden zu leben.
Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit
überhandnehmen,
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Unterschiede in Sprache,
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind und
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame
Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Menschen gegen Menschen
ausgespielt werden,
wenn Macht ausgenutzt wird,
um andere auszubeuten,
wenn Tatsachen verdreht werden,
um andere zu täuschen, bist du es,
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Lehre uns, gerecht und fürsorglich
miteinander umzugehen und der
Korruption zu widerstehen.
Schenke uns mutige Frauen und Männer,
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt
an Leib und Seele hinterlassen.
Lass uns die richtigen Worte, Gesten und
Mittel finden, um den Frieden zu fördern.
In welcher Sprache wir dich auch als
„Fürst des Friedens“ bekennen,
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein
gegen Gewalt und gegen Unrecht.
Amen.
Weitere Infos: https://www.oekumenisches-friedensgebet.de/
Bischof Meier: Vorgaben für Einsatz bewaffneter Drohnen schärfen
(KNA)

Quelle: Shutterstock
Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat eine Präzisierung des Völkerrechts im Blick auf Kampfdrohnen gefordert. „Ich glaube, dass der Einsatz bewaffneter Drohnen ethisch gerechtfertigt werden kann und es auch richtig war, die deutsche Bundeswehr damit auszurüsten“, sagte der Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz am Donnerstag auf einem Katholikentags-Podium in Stuttgart.
Dennoch drohe die völkerrechtliche Legitimität bei genauerem Hinsehen auf wackligen Beinen zu stehen. Der Bischof erläuterte, das Völkerrecht sei nicht immer eindeutig genug, wann Kampfdrohnen rechtmäßige Mittel seien, um den Feind zu bekämpfen. In den vergangenen Jahrzehnten nehme die Bekämpfung nicht-staatlicher Konfliktparteien wie etwa Terroristen zu, die teilweise über Ländergrenzen hinweg aktiv seien. „Hier ist es mehr als fraglich, inwieweit man diese Kämpfer über Ländergrenzen hinweg, zum Beispiel eben mit bewaffneten Drohnen, bekämpfen darf. Auch wenn viele Länder, allen voran die USA, diese Rechtsunsicherheit zum eigenen Vorteil weit auslegen, bleibt eine Rechtsunsicherheit bestehen“, betonte Meier.
Er appellierte an die Bundesregierung, darauf hinzuwirken, dass die hier gezeigte Lücke im Völkerrecht geschlossen wird und die Bundeswehr bewaffnete Drohnen nur nach Maßgabe einer engen Rechtsauslegung einsetzt. Mit der Anschaffung von Kampfdrohnen gehe auch eine Verantwortung einher.
Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau betonte: „Wir müssen im Bundestag unbedingt diskutieren, was das ethische Korsett für den Einsatz solcher Waffensysteme ist.“ Das sei bislang zu wenig geschehen. Es müssten Fragen beantwortet werden wie etwa: Was macht es mit einer Zivilbevölkerung, über der lange Zeit bewaffnete Drohnen kreisen, und die sich fragt, wofür sie eingesetzt werden.
Auch die Auswirkungen auf die Soldaten in solch einem Einsatz müssten in den Blick genommen werden. Sie persönlich lehne diese Waffensysteme ab, sagte die Linken-Politikerin, die auch religionspolitische Sprecherin ihre Fraktion ist.
Ansgar Rieks, Generalleutnant der Bundeswehr, erläuterte, der Bundestag definiere und regele mit seinem Mandat für Kampfdrohnen auch die Einsatzrahmenbedingungen sehr detailliert: „Die Gefahr von Missbrauch ist dadurch meines Erachtens weitgehend gebannt.“ Auch sei er der Ansicht, dass es Drohnen durch ihre hohe Flexibilität und Genauigkeit leichter machten, ethische Kriterien im Krieg einzuhalten. Zugleich räumte Rieks ein, dass der Einsatz etwa für Drohnenpiloten, die das Geschehen sehen, belastend sei.
Zur Stellungnahme der GKS zur Frage der Bewaffnung von Drohne: https://gemeinschaft-katholischer-soldaten.de/themen/drohnen
Europapolitiker: Gesamte Freiheit steht bei Krieg auf dem Spiel
KNA
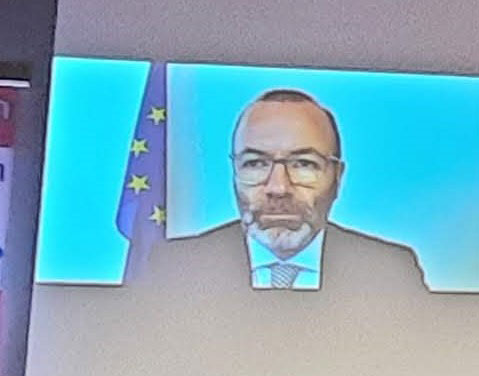 Manfred Weber MdEP, Fraktionsvorsitzende
Manfred Weber MdEP, Fraktionsvorsitzende
Für den Europapolitiker Manfred Weber (CSU) (digital zugeschaltet) steht beim russischen Angriff auf die Ukraine das gesamte freiheitliche und demokratische Lebensmodell auf dem Spiel. „Es geht um unser auf christlichen Werten gründendes Lebensmodell“, sagte der Fraktionsvorsitzende EVP im Europaparlament am Samstag beim Katholikentag in Stuttgart.
„Es ist kein regionaler Krieg, sondern es ist unser Krieg, nicht weil wir direkte Kriegspartei wären, was wir unbedingt verhindern müssen. Aber es ist unser Krieg, weil die universalen Werte in Gefahr sind“, betonte Weber. „Autokraten wie Putin dürfen nicht gewinnen.“
 Ivanna Klympush-Tsintsadze ehem. Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, Kiew/Ukraine
Ivanna Klympush-Tsintsadze ehem. Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, Kiew/Ukraine
Die ukrainische Parlamentarierin Ivanna Klympush-Tsintsadze (digital zugeschaltet) sagte, die Ukraine sei dankbar für jede Unterstützung - materiell, aber auch moralisch und geistlich. „Russland versucht, uns auszuradieren als Staat und als Nation. Und den Bürgern in Deutschland muss klar sein, dass wir jetzt einen Präzedenzfall erleben für die Zukunft“, so Klympush-Tsintsadze, die digital aus ihrem Heimatland zugeschaltet wurde. Es entscheide sich jetzt, wie die Weltgemeinschaft auf die Aggression von Autokraten reagiere. Sie forderte weitere, umfassende militärische Unterstützung für die Ukraine. „Sonst können wir die russischen Truppen nicht stoppen - und dann werden sie immer weiter vorrücken.“ Es sei daher falsch, Waffenlieferungen abzulehnen, mit dem Argument dies würde die Gesamtsituation eskalieren. „Das Gegenteil ist der Fall. Russland ist an Dialog oder Versöhnung nicht interessiert. Moskau will, dass wir aufhören zu existier“
Die Grünen-Bundestagsvize Agnieszka Brugger sagte, „unsere Sicherheit und unsere Freiheit werden gerade in der Ukraine verteidigt“. Deshalb müsse Deutschland jeden Tag neu überlegen, „was wir noch mehr machen können: mit Waffen, aber auch für den Wiederaufbau oder für Hilfen für vergewaltigte Frauen“.
Laut dem Jahresbericht 2021 von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres über den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten waren 2020 weltweit mehr als 50 Millionen Menschen von Konflikten in städtischen Gebieten betroffen. Wenn Explosivwaffen in Wohngebieten eingesetzt werden, stammen nach Angaben der Organisation 90 Prozent der Getöteten und Verletzten aus der Zivilbevölkerung.
 Agnieszka Brugger MdB, stell. Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss; Moderation Dr. Markus Ingenlath, Freising; Prof. Dr. Carlo Masala, Politikwissensch
Agnieszka Brugger MdB, stell. Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss; Moderation Dr. Markus Ingenlath, Freising; Prof. Dr. Carlo Masala, Politikwissensch
Pressestimmen zum Katholikentag 2022:
Vier Jahre nach Münster fand in Stuttgart wieder ein Katholikentag statt, das erste große „echte“ Kirchentreffen nach der Corona-Pandemie. Eine erste Bilanz.
Ein Katholikentag im Zeichen der Zeitenwende -
Kanzler, Krisen und ein Krieg
Von Joachim Heinz (KNA)
Das Herz des Katholikentages in Stuttgart schlägt rund um den Schlossplatz. Vor alten Bauten und neuen Konsumtempeln stehen die weißen Pavillons der Kirchentagsmeile. Hilfswerke werben um Spenden, Pfarrsekretärinnen stellen ihren Beruf vor, Kirchenchöre singen. Bunt geht es zu auf der Königstraße, Stuttgarts zentraler Einkaufsmeile. Grell geschminkte Shopping-Queens treffen auf Christenmenschen mit korallenfarbenen Katholikentags-Schals. Vertraute Bilder - einerseits. Andererseits ist vieles anders bei diesem ersten großen Kirchentreffen nach der Corona-Pandemie. Die Gesamtzahl der Teilnehmer beziffern die Organisatoren auf rund 25.000. Das ist deutlich weniger als noch beim Katholikentag 2018 in Münster, als 80.000 Besucher gezählt wurden. Bei vielen der 1.500 Veranstaltungen bleiben Plätze frei. Das gilt auch für die Auftritte der Spitzenpolitiker, die normalerweise zu den Zugnummern bei Katholiken- oder evangelischen Kirchentagen zählen. Folgen der Pandemie - aber auch einer Entfremdung zwischen Kirche und Gesellschaft, die der Missbrauchsskandal beschleunigt hat. Das Thema war auch diesmal fast omnipräsent. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich gleich zwei Tage Zeit für seinen Besuch beim Katholikentag nimmt, treibt die Sorge vor einem Bedeutungsverlust der Kirchen um. „Unsere Gesellschaft braucht eine starke Kirche, die relevant ist.“ So ähnlich formulieren es auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), seine sozialdemokratische rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer oder SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Während SPD und Grüne in Stuttgart stark vertreten sind, die Linke zu einem politischen Nachtgebet lädt, machen sich Vertreter von CDU, CSU und FDP rar. Eine Zeitenwende? Vielleicht - wenn dieses Wort nicht seit dem 24. Februar für den Überfall Russlands auf die Ukraine reserviert wäre.
„leben teilen“ lautete das offizielle Motto dieses Katholikentags. Dazu gehört auch, Verzweiflung und Ängste zu teilen. Ein unbeschwertes und fröhliches Fest des Glaubens, das war im Vorfeld schon klar, konnte das Treffen in Stuttgart angesichts der aktuellen Entwicklungen in Kirche und Politik nicht sein. Stattdessen wurde Stuttgart ein Katholikentag zwischen Bangen und Hoffen, zwischen Hilfe und Hilflosigkeit.
Entwicklungsministerin Schulze: Größte Hungerkrise seit 1945
(KNA)

Quelle: Pixabay
Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) warnt vor der grössten Hungerkrise seit 1945 und fordert ein Ende der Nutzung von Lebensmitteln für Biokraftstoffe.
„Die Lage ist hochdramatisch. Durch Corona, extreme Dürren und jetzt den Krieg haben sich die Lebensmittelpreise weltweit um ein Drittel erhöht und sind jetzt auf Rekordniveau“, sagte sie. „Die bittere Botschaft ist: Uns droht die grösste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg mit Millionen Toten.“ „Das ist auch ein konkretes Ergebnis der Erpressbarkeit durch Lebensmittel.“ Um die Zahl der verfügbaren Lebensmittel auf der Welt zu erhöhen, forderte Schulze einen internationalen Stopp der Nutzung von Lebensmitteln für Biokraftstoffe. 4,4 Prozent im Sprit seien Nahrungs- und Futtermittel. Das müsse auf Null heruntergefahren werden, nicht nur in Deutschland, sondern möglichst international. Das entspricht fast der halben Sonnenblumenölernte der Ukraine.
Ukraine-Krieg trifft auch Afrika
Hunger und Angst vor Unruhen Brennende Barrikaden, geplünderte Supermärkte, Leichen in den Straßen - das kennen die Südafrikaner von den Unruhen, die das Land vergangenen Juli erschütterten. Jetzt warnen Experten: Das Chaos könnte sich wiederholen.
Von Markus Schönherr (KNA)
„Niemals zuvor haben wir größere Herausforderungen dabei erlebt, Frieden und Entwicklung gleichzeitig aufrechtzuerhalten“, sagt Ahunna Eziakonwa, Afrika-Direktorin des UN-Entwicklungsprogramms UNDP. Der Kontinent sei aufgrund seiner Abhängigkeit unverhältnismäßig stark von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen. So sehr, dass Experten jetzt erstmals vor politischen Unruhen warnen. Damit steigende Lebensmittelpreise nicht in Gewalt ausarten, sei es wichtig, jetzt gegenzusteuern.
Südafrika galt nach dem Ende der Apartheid 1994 als afrikanisches Hoffnungsland. Doch selbst in der zweitstärksten Wirtschaftsmacht am Kontinent ist Hunger heute auf dem Vormarsch. Allein in den ersten zwei Monaten dieses Jahres seien täglich mehr als drei Kinder an Unterernährung gestorben, berichtet die südafrikanische Sunday Times. In manchen Regionen der Kap-Republik seien Kinder dazu übergegangen, Sand zu essen, um ihre Mägen zu füllen.

Meldungen aus Kirche und Welt
UN: Erklärung gegen Explosivwaffen in Wohngebieten geplant
KNA
 Bild: iStock
Bild: iStock
In Genf wollen in dieser Woche Vertreter von mehr als 70 Staaten, UN-Organisationen, humanitären Organisationen und der Zivilgesellschaft eine politische Erklärung gegen den Einsatz von Explosivwaffen in Wohngebieten aushandeln.
Angesichts der verheerenden Bombardierungen der Zivilbevölkerung in der Ukraine, in Jemen oder Syrien sei ein internationales Abkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Explosivwaffen in Wohngebieten dringend erforderlich, erklärte die Organisation Handicap International (Dienstag) in München.
Seit zwei Jahren wird um eine politische Erklärung gerungen, die den Einsatz von Mörsergranaten, Raketen, Artilleriegranaten oder Sprengfallen in bewohnten Gebieten regeln soll. Zudem sollen bei der dreitägigen Konferenz in Genf Hilfen für Opfer sowie eine Verpflichtung für das Militär festgeschrieben werden, die Zivilbevölkerung besser zu schützen.
Unter der Leitung Irlands hatte dieser diplomatische Prozess im Oktober 2019 begonnen, wurde aber durch die Corona-Pandemie unterbrochen und verzögert. Die massiven und systematischen Bombardierungen hätten die schlimmste humanitäre Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, beklagt Handicap International. Explosivwaffen verursachen schreckliches Leid. Wenn sie nicht töteten, fügten sie ihren Opfern Verletzungen zu, die oft zu lebenslangen Behinderungen und schweren Traumata führten. Sie zerstörten Häuser, Schulen, Krankenhäuser - sodass Verletzte oft nicht einmal versorgt werden können.
Laut dem Jahresbericht 2021 von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres über den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten waren 2020 weltweit mehr als 50 Millionen Menschen von Konflikten in städtischen Gebieten betroffen. Wenn Explosivwaffen in Wohngebieten eingesetzt werden, stammen nach Angaben der Organisation 90 Prozent der Getöteten und Verletzten aus der Zivilbevölkerung.